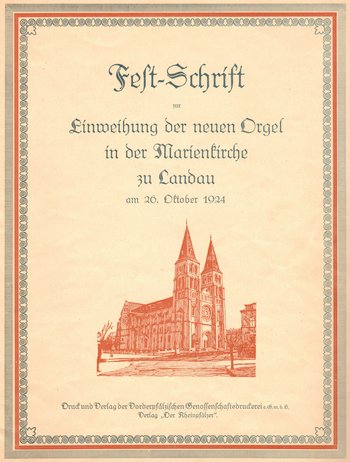Die Steinmeyer-Orgel 1924
Bereits ein Jahr vor der Konsekration der Marienkirche 1911 gab es Vorüberlegungen hinsichtlich der Anschaffung einer Orgel. Fehlende Mittel und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs erzwangen eine Verschiebung des Projektes.
Zuerst: Solenner Auftakt vor vollem Hause
Am 26. Oktober 1924 fand durch Bischof Dr. Ludwig Sebastian die feierliche Weihe der Orgel aus dem Hause G.F. Steinmeyer & Co statt.
"Um einer Ueberfüllung vorzubeugen, können zu dieser Feier nur Pfarrangehörige und die geladenen Cäcilienvereine zugelassen werden. Für die breite Oeffentlichkeit findet am 1. Nov. nachmittags 3 Uhr ein Künstler-Konzert statt.“
Dieser bemerkenswerte Satz findet sich auf der „Vortrags-Folge der kirchenmusikalischen Aufführung am 26. Oktober 1924“, die nachmittags im Anschluss an die „Ansprache des Hochwürdigsten Herrn Bischofs“ in der Landauer Pfarrkirche St. Maria erklang.
Am Vormittag desselben Tages fand die Weihe der neuen Orgel der Firma G. F. Steinmeyer & Co mit der Opusnummer 1384 durch Bischof Dr. Ludwig Sebastian statt. Es war mit 72 Registern das zweitgrößte Instrument der Pfalz, übertroffen nur von der Orgel im Dom zu Speyer. Die Disposition weist neben den typischen deutsch-romantischen Registern auch eine Vielzahl von Stimmen auf, die aus dem französischen Orgelbau übernommen wurden, so etwa die Zungenbatterie des III. Manuals und verschiedene Aliquoten. Die Orgel repräsentiert damit ein spätes, aber sehr bedeutendes Beispiel der elsässisch-neudeutschen Orgelreform, einem Vorläufer der späteren Orgelbewegung, die dann die norddeutsche Barockorgel als Maß aller Dinge postulierte.
Im auf die Weihe folgenden „Feierlichen Pontifikalamt“ brachte der Pfarrcäcilienverein die „Missa in honorem Sanctae Luciae“ von Witt zur Aufführung. An der Orgel saß Domorganist Jacob aus Speyer.
Für die Landauer Katholiken war es ohne Zweifel ein großer Tag: Dreizehn Jahre hatten sie in der 1911 geweihten Marienkirche (bis auf den heutigen Tag die größte Kirche des Bistums Speyer nach dem Kaiserdom und ein charakteristisches Bauwerk des späten Historismus) ohne Orgel auskommen müssen.
Das „für die breite Öffentlichkeit“ in Aussicht gestellte Orgelkonzert von Franz Philipp („Direktor des Bad. Konservatoriums Karlsruhe“) gefiel jedoch in einer Besprechung des „Pfälzischen Anzeigers“ vom 2. November 1924 nur teilweise – besonders die abschließende Improvisation Philipps über „Ein Haus voll Glorie schauet“ brachte den gestrengen Herrn Kritiker ganz aus dem Häuschen:
„Wir fragen Herrn Direktor Philipp ernstlich, ob er sich eine solche sogenannte Improvisation in Karlsruhe, Sophienstraße 9, von irgend einem Schüler gefallen ließe? Mit Verlaub! Wir mußten uns von 4 Uhr 56 bis 5 Uhr 21, das sind volle 25 Minuten, martern lassen. (…) Nach manchem glücklichen Ansatz, der natürlich nie durchgeführt wurde, ging ein rasender Höllenspektakel von Läufern, Trillern, ein Aechzen und Stöhnen, ein Brummen und wildes Schreien los, bis endlich ein richtiger, handvoller Triller mit voller Orgel die Seele des Improvisators ausspie!“
Danach: Bombenkrieg und fragwürdige Instandsetzung
Doch am 16. März 1945 wurden Kirche und Orgel durch Kriegseinwirkungen schwer beschädigt. Die im März 1945 - nur wenige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner - zusammen mit der Kirche schwer beschädigte Orgel wurde 1956/57 durch die Erbauerfirma instand gesetzt. Dabei wurden Prospekt und Klang des Instrumentes versachlicht und im Geiste der fünfziger Jahre „norddeutsch“ „barockisiert“. Zwei der drei Schwellwerke wurden entfernt, manche Pfeife erhielt neue Labien und Kerne, Aufschnitte wurden erniedrigt, neue hochliegende Aliquote und neobarocke Zungenstimmen fanden ihren Weg in die Orgel, der Wind wurde verändert.
Der damalige Orgelexperte und Domorganist von Speyer, Ludwig Doerr, schrieb in seinem Abnahmegutachten:
„Die Umdisposition geschah ökonomisch, es wurde an Pfeifenmaterial so viel belassen bzw. wiederverwendet als nur irgendwie möglich war.“
Was sich 53 Jahre später als Glücksfall herausstellen sollte.